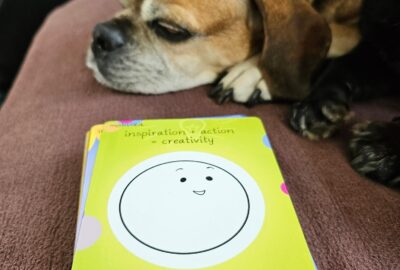Allgemein
Nähe und Distanz bei der Behandlung psychisch erkrankter Menschen
Ergotherapie behandelt Beeinträchtigungen. Allerdings nicht nur die sichtbaren. Sichtbare Beeinträchtigungen haben beispielsweise Menschen mit Störungen des Bewegungsapparates infolge von Schlaganfall, Arthrose oder rheumatischen Erkrankungen, um hier nur ein paar zu nennen. Diese neurologischen oder orthopädischen Erkrankungen kann ein Außenstehender gleich sehen. Was jedoch nicht auffällt, sind psychische Erkrankungen, die wir Ergotherapeuten auch behandeln, wie z. B. Persönlichkeitsstörung, Traumata, Depression, Sucht, Angst- und Zwangsstörungen, Schizophrenie.
Diese Erkrankungen führen zu einer Einschränkung der Lebensqualität. Unsere Aufgabe ist es, diese wiederherzustellen. Bei uns Ergotherapeuten heißt diese Behandlungsform psychisch-funktionelle Behandlung. Laut Heilmittelkatalog der Krankenkassen dient die psychisch-funktionelle Behandlung „der gezielten Therapie krankheitsbedingter Störung der psychosozialen und sozioemotionalen Funktion und der daraus resultierenden Fähigkeitsstörungen.“
Irvin D. Yalom, Professor für Psychiatrie an der Stanford University und einer der angesehensten Psychotherapeuten Amerikas, sagte einmal, dass wir Therapeuten dafür da seien, Hindernisse zu beseitigen, die den Weg unserer Klienten blockieren. Den Rest, den Wunsch zu wachsen, die Neugier, das Wollen, die Fürsorglichkeit und Loyalität etc., würde angetrieben von Selbstverwirklichungskräften des Klienten automatisch folgen.
Nur die Frage ist, wie machen wir das?
Schon allein bei der Erstaufnahme kommt der Klient mit dem Wissen zu uns, dass wir mit
unseren Therapiebegleithunden arbeiten. Der Klient mag vermutlich Tiere, freut sich vielleicht auch auf die Hunde und sieht diese Erstkontaktaufnahme erst mal nicht als etwas Schlimmes an, möglicherweise sogar als etwas Positives. Von einigen meiner Klienten weiß ist, dass sie das erste Mal, als sie zu uns kamen, schon sehr unsicher waren. Sie wussten nicht, was auf sie zukommen würde, gleichzeitig aber besaßen sie die Neugierde auf die Hunde. Der Antrieb, die Motivation, diesen Weg zu gehen, der ja immer mit Unsicherheiten besetzt ist, waren also unsere Hunde. Und wir Therapeuten werden gleich automatisch positiv besetzt, als sympathisch angesehen, weil wir Besitzer eines Hundes sind und weil wir unsere Hunde in die therapeutischen Settings integrieren. Schon am suchenden Blick erkenne ich, wenn ich die Tür aufmache, die Frage: „Wo sind die Hunde?“. Damit ist der Anfang gemacht. Der Hund schlägt gleich eine Brücke zwischen dem Klienten und dem Therapeuten und ist sofort Gesprächsthema.
Wie gestalten wir das weitere Setting?
Ich bin der Meinung, dass wir Therapeuten gerade im Bereich der psychiatrischen Erkrankungen dem Klienten eine gewisse Offenheit entgegenbringen müssen, damit wir auch die Offenheit des Klienten bekommen. Einige meiner Kollegen sehen das anders und wahren die Distanz. Doch die ist hier, denke ich, eher hinderlich. So wie unsere Hunde eine Vertrautheit schaffen, ist Distanz in diesem Bereich eher unangebracht. Der Klient vertraut uns – wenn es gut läuft – sein komplettes Innerstes an. Je mehr wir die Klienten kennenlernen, je mehr wir Gespräche miteinander führen, desto mehr müssen die Klienten preisgeben. Ein Mensch gibt mehr preis, wenn der Therapeut in der Lage ist, auch mal Privates über sich zu erzählen. Ein Therapeut sollte so empathisch wie nur möglich sein, was nur funktioniert, wenn er offen ist, wenn er sich selbst gut kennt und in der Lage ist, sich selbst und andere zu reflektieren. Damit zeigt er dem Klienten, der das noch nicht kann, wie es geht, dient sozusagen als Vorbild. Klienten profitieren enorm von der Erfahrung eines Therapeuten, der sie richtig sieht und versteht und eben auch von seiner Offenheit.
Nähe-Distanz-Regulierung
Wir hatten mal eine Pflegefachkraft in einer sozialen Einrichtung gehabt, die sehr auf Distanz gearbeitet hat. Sie hat ihre Arbeit verrichtet, war aber selbst mir gegenüber sehr distanziert und letztendlich eher unsympathisch. Ich wusste, dass auch andere Bewohner diese Pflegefachkraft nicht sonderlich mochten. Warum ließ sie keine Nähe zu? Warum ging sie so extrem auf Distanz? Ich glaube, dass besonders die frühere Generation diese extreme Distanz gewahrt hat. Man fragte sich damals, was wohl die anderen Leute über einen dachten. Es war anscheinend wichtig, dass das Ansehen keinesfalls in Misskredit gezogen wurde. Aus diesem Grund ließ man die Menschen nicht so nah an sich ran, baute Distanz auf, wahrte den Schein. In der heutigen Zeit ist extreme Distanz einfach nur altbacken.
In einem anderen Heim gab es eine Hauswirtschafterin, die hat sich tatsächlich in einen Bewohner verliebt. Sie hat zu viel Nähe zugelassen, jedoch Verantwortung übernommen und die Stelle gekündigt, um die Beziehung zum Bewohner weiterzuführen. Das passiert, wir alle sind nur Menschen. Dennoch bin ich der Meinung, dass ein Therapeut eine gewisse Nähe zulassen und mit Respekt und Akzeptanz eine Beziehung zum Klienten aufrechterhalten kann, die etwas weitergeht als die altmodische Patienten-Therapeut-Beziehung.
Eine gewisse Nähe unbedingt zulassen
Wenn unsere Klienten eine Begleitperson zum Besuch eines Comedians suchen, dann gehen wir von ErgoDog oft mit. Für manche ist das distanzlos. Doch warum? Was ist daran so schlimm? Was sollte daran falsch sein? Wie genau kann dadurch die Therapeuten-Klienten-Beziehung gefährdet werden? Habe ich da nicht eher was gemacht, was diese Beziehung fördert? Wir haben teilweise langjährige Klienten, mit denen wir nun schon seit mittlerweile zehn Jahren zusammenarbeiten. Natürlich wird da eine engere Beziehung aufgebaut, das geschieht doch ganz automatisch. Wie emotionslos und gefühlskalt kann man denn sein, wenn man einen Klienten, den man schon eine so lange Zeit kennt, nicht nah an sich heranlässt? Außerdem bin ich der Meinung, dass es von Vorteil sein kann, wenn man eine gewisse Nähe zum Klienten zulässt. Der Klient, der möglicherweise im psychiatrischen Bereich Probleme mit Beziehungen hat, lernt dadurch, wie man mit anderen Menschen umgeht. Unsere Beziehung, also die zwischen Therapeut und Klient, dient sozusagen wieder als Vorbild und wird möglicherweise auch in den privaten Bereich projiziert. Sie kann also ein Automatismus auslösen. So erhalten die Klienten ein Verständnis zwischenmenschlicher Interaktion und können das auf andere übertragen.
Wie kann ein Hund bei der Therapie helfen?
Unsere Hunde sind eine Bereicherung. Nicht nur als Motivation und Erleichterung des Erstkontakts, sondern auch während der Ergotherapie mit Menschen mit psychischen Erkrankungen. Der Klient lernt mit uns zusammen, wie er mit dem Hund interagieren und kommunizieren kann, wie er mit dem Hund umgehen soll. Er erfährt vieles über das Ausdrucksverhalten des Hundes, denn nur wenn man seine Signale richtig versteht, ist eine Kommunikation mit dem Hund möglich. Außerdem lernt der Klient seine eigenen Bedürfnisse kennen und diese durchzusetzen oder sich selbst abzugrenzen, auch in Bezug auf unsere Hunde. Abgrenzung und Durchsetzung – nicht nur gegenüber unseren Hunden – sind wichtige Punkte. Wie reagiert der Hund und wie reagiert der Klient? Was muss ich an mir verändern, damit der Hund mir folgt? Ein Hund folgt nämlich keinen instabilen Menschen…
Nähe ist nicht schädlich, im Gegenteil!
Nähe und Distanz ist ein Thema, was definitiv reflektiert werden muss. Nähe kann keinen Schaden anrichten, da bin ich mir sicher. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, dass man bei zu viel Nähe Verantwortung übernehmen muss, wie die Hauswirtschafterin in der sozialen Einrichtung. Aber solche Dinge können nun mal passieren. Menschen machen Fehler. Wichtig ist nur, wie man damit umgeht. Habe ich einen Fehler gemacht, sei es innerhalb der Therapiesequenz oder im privaten Umfeld, dann ist es wichtig, dass ich den Fehler zugebe anstatt ihn zu vertuschen oder zu verheimlichen. Auch daraus können die Klienten lernen. Sie erkennen, dass der Therapeut einen Fehler gemacht hat und diesen zugibt. Menschlich. Und im besten Fall übernimmt der Klient diese Verhaltensweise in seinem Leben.
Akzeptanz und Unterstützung ist enorme Bestätigung
Yalom sagt dazu: „Akzeptanz und Unterstützung von jemandem, der einen so gut kennt, ist eine enorme Bestätigung für den Klienten.“ Und das denke ich auch. Und er sagt auch, dass die Selbsterforschung ein lebenslanger Prozess sei. Unsere Klienten stehen da meist noch am Anfang, wenn sie zu uns kommen. Die Aufgabe des Therapeuten ist es, sie in ihrem Prozess der Selbsterforschung zu unterstützen und die wirklichen Schwierigkeiten des Lebens versuchen, gemeinsam aus dem Weg zu räumen. Wir müssen unsere Klienten dahingehend unterstützen, dass sie einen besseren Umgang mit ihrer Erkrankung erlernen. Erst wenn der Klient seine z. B. Depression annimmt und akzeptiert, kann der Therapeut Wege aufzeigen, wie der Klient selbst mit der Erkrankung umgehen und wie er dafür sorgen kann, wie sein Umfeld damit umgeht. Und ohne eine gewisse Nähe zwischen Therapeut und Klient ist das nicht möglich.